


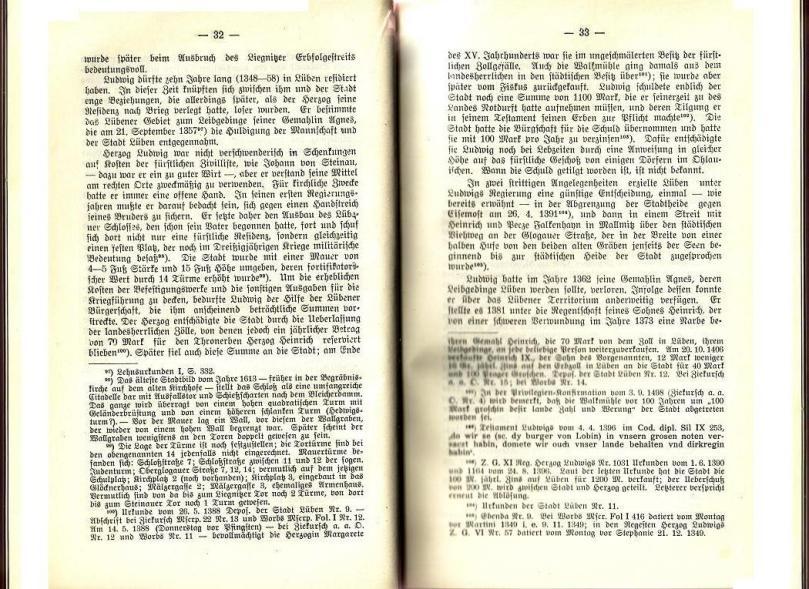
|
- 32 - wurde später beim Ausbruch des Liegnitzer Erbfolgestreits bedeutungsvoll. Ludwig dürfte zehn Jahre lang (1348-58) in Lüben residiert haben. In dieser Zeit knüpften sich zwischen ihm und der Stadt enge Beziehungen, die allerdings später, als der Herzog seine Residenz nach Brieg verlegt hatte, loser wurden. Er bestimmte das Lübener Gebiet zum Leibgedinge seiner Gemahlin Agnes, die am 21. September 135797) die Huldigung der Mannschaft und der Stadt Lüben entgegennahm. Herzog Ludwig war nicht verschwenderisch in Schenkungen auf Kosten der fürstlichen Zivilliste, wie Johann von Steinau, - dazu war er ein zu guter Wirt -, aber er verstand seine Mittel am rechten Orte zweckmäßig zu verwenden. Für kirchliche Zwecke hatte er immer eine offene Hand. In seinen ersten Regierungs- jahren mußte er darauf bedacht sein, sich gegen einen Handstreich seines Bruders zu sichern. Er setzte daher den Ausbau des Lübe- ner Schlosses, den schon sein Vater begonnen hatte, fort und schuf sich dort nicht nur eine fürstliche Residenz, sondern gleichzeitig einen festen Platz, der noch im Dreißigjährigen Kriege militärische Bedeutung besaß98). Die Stadt wurde mit einer Mauer von 4-5 Fuß Stärke und 15 Fuß Höhe umgeben, deren fortifikatori- scher Wert durch 14 Türme erhöht wurde99). Um die erheblichen Kosten der Befestigungswerke und die sonstigen Ausgaben für die Kriegführung zu decken, bedurfte Ludwig der Hilfe der Lübener Bürgerschaft, die ihm anscheinend beträchtliche Summen vor- streckte. Der Herzog entschädigte die Stadt durch die Ueberlassung der landesherrlichen Zölle, von denen jedoch ein jährlicher Betrag von 70 Mark für den Thronerben Herzog Heinrich reserviert blieben100). Später fiel auch diese Summe an die Stadt; am Ende 97 Lehnsurkunden I, S. 332. 98 Das älteste Stadtbild vom Jahre 1613 - früher in der Begräbnis- kirche auf dem alten Kirchhofe - stellt das Schloß als eine umfangreiche Citadelle dar mit Ausfallstor und Schießscharten nach dem Bleicherdamm. Das ganze wird überragt von einem hohen quadratischen Turm mit Geländerbrüstung und von einem höheren schlanken Turm (Hedwigs- turm?). - Vor der Mauer lag ein Wall, vor diesem der Wallgraben, der wieder von einem hohen Wall begrenzt war. Später scheint der Wallgraben wenigstens an den Toren doppelt gewesen zu sein. 99 Die Lage der Türme ist noch festzustellen; die Tortürme sind bei den obengenannten 14 jedenfalls nicht eingerechnet. Mauertürme be- fanden sich: Schloßstraße 7; Schloßstraße zwischen 11 und 12 der sogen. Judenturm; Oberglogauer Straße 7, 12, 14; vermutlich auf dem jetzigen Schulplatz; Kirchplatz 2 (noch vorhanden); Kirchplatz 3, eingebaut in das Glöcknerhaus; Mälzergasse 2; Mälzergasse 3, ehemaliges Armenhaus. Vermutlich sind von da bis zum Liegnitzer Turm noch 2 Türme, von dort bis zum Steinauer Turm noch 1 Turm gewesen. 100 Urkunde vom 26.5.1388 Depos. der Stadt Lüben Nr. 9. - Abschrift bei Ziekursch Mscrp. 22 Nr. 13 und Worbs Mscrp. Fol. I Nr. 12. Am 14.5.1388 (Donnerstag vor Pfingsten) - bei Ziekursch a.a.O. Nr. 12 und Worbs Nr. 11 - bevollmächtigt die Herzogin Margarete |
- 33 - des XV. Jahrhunderts war sie im ungeschmälerten Besitz der fürst- lichen Zollgefälle. Auch die Walkmühle ging damals aus dem landesherrlichen in den städtischen Besitz über101); sie wurde aber später vom Fiskus zurückgekauft. Ludwig schuldete endlich der Stadt noch eine Summe von 1100 Mark, die er seinerzeit zu des Landes Notdurft hatte aufnehmen müssen, und deren Tilgung er in seinem Testament seinen Erben zur Pflicht machte102). Die Stadt hatte die Bürgschaft für die Schuld übernommen und hatte sie mit 100 Mark pro Jahr zu verzinsen103). Dafür entschädigte sie Ludwig noch bei Lebzeiten durch eine Anweisung in gleicher Höhe auf das fürstliche Geschoß von einigen Dörfern im Ohlau- ischen. Wann die Schuld getilgt worden ist, ist nicht bekannt. In zwei strittigen Angelegenheiten erzielte Lüben unter Ludwigs Regierung eine günstige Entscheidung, einmal - wie bereits erwähnt - in der Abgrenzung der Stadtheide gegen Eisemost am 26.4.1391104), und dann in einem Streit mit Heinrich und Pecze Falkenhayn in Mallmitz über den städtischen Viehweg an der Glogauer Straße, der in der Breite von einer halben Hufe von den beiden alten Gräben jenseits der Seen be- ginnend bis zur städtischen Heide der Stadt zugesprochen wurde105). Ludwig hatte im Jahre 1362 seine Gemahlin Agnes, deren Leibgedinge Lüben werden sollte, verloren. Infolge dessen konnte er über das Lübener Territorium anderweitig verfügen. Er stellte es 1381 unter die Regentschaft seines Sohnes Heinrich, der von einer schweren Verwundung im Jahre 1373 eine Narbe be- ihren Gemahl Heinrich, die 70 Mark von dem Zoll in Lüben, ihrem Leibgedinge, an jede beliebige Person weiterzuverkaufen. Am 20.10.1406 verkaufte Heinrich IX., der Sohn des Vorgenannten, 12 Mark weniger 10 Gr. jährl. Zins auf den Erbzoll in Lüben an die Stadt für 40 Mark und 100 Prager Groschen. Depos. der Stadt Lüben Nr. 12. Bei Ziekursch a.a.O. Nr. 15; bei Worbs Nr. 14. 101 In der Privilegien-Konfirmation vom 3.9.1498 (Ziekursch a.a. O. Nr. 4) wird bemerkt, daß die Walkmühle vor 100 Jahren um "100 Mark groschin desir lande Zahl und Werung" der Stadt abgetretem worden sei. 102 Testament Ludwigs vom 4.4.1396 im Cod. dipl. Sil IX 253, ‚do wir sc (sc dy burger von Lobin) in vnsern grosen noten ver- saczt habin, domete wir ouch vnser lande behalten vnd dirkregin habin'. 103 Z. G. XI Reg. Herzog Ludwigs Nr. 1031 Urkunden vom 1.6.1390 und 1164 vom 24.8.1396. Laut der letzten Urkunde hat die Stadt die 100 M. jährl. Zins auf Lüben für 1200 M. verkauft; der Ueberschuß von 200 M. wird zwischen Stadt und Herzog geteilt. Letzterer verspricht erneut die Ablösung. 104 Urkunden der Stadt Lüben Nr. 11. 105 Ebenda Nr. 9. Bei Worbs Mscr. Fol I 416 datiert vom Montag vor Martini 1349 i. e. 9.11.1349; in den Regesten Herzogs Ludwigs Z. G. VI Nr. 57 datiert vom Montag vor Stephanie 21.12.1349. |