


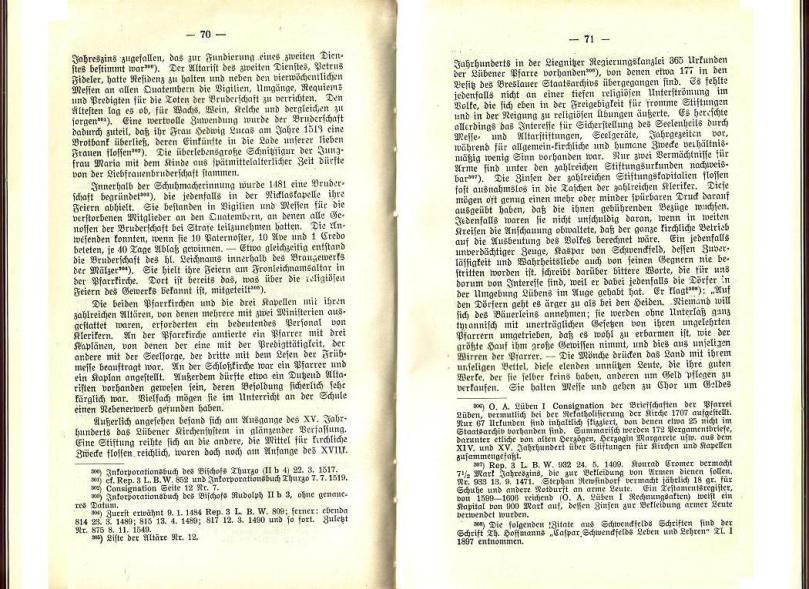
|
- 70 - Jahreszins zugefallen, das zur Fundierung eines zweiten Dien- stes bestimmt war300). Der Altarist des zweiten Dienstes, Petrus Fideler, hatte Residenz zu halten und neben den vierwöchentlichen Messen an allen Quatembern die Vigilien, Umgänge, Requiems und Predigten für die Toten der Bruderschaft zu verrichten. Den Ältesten lag es ob, für Wachs, Wein, Kelche und dergleichen zu sorgen301). Eine wertvolle Zuwendung wurde der Bruderschaft dadurch zuteil, daß ihr Frau Hedwig Lucas am Jahre 1513 eine Brotbank überließ, deren Einkünfte in die Lade unserer lieben Frauen flossen302). Die überlebensgroße Schnitzfigur der Jung- frau Maria mit dem Kinde aus spätmittelalterlicher Zeit dürfte von der Liebfrauenbruderschaft stammen. Innerhalb der Schuhmacherinnung wurde 1418 eine Bruder- schaft begründet303), die jedenfalls in der Nicklaskapelle ihre Feiern abhielt. Sie bestanden in Vigilien und Messen für die verstorbenen Mitglieder an den Quatembern, an denen alle Ge- nossen der Bruderschaft bei Strafe teilzunehmen hatten. Die An- wesenden konnten, wenn sie 10 Paternoster, 10 Ave und 1 Credo beteten, je 40 Tage Ablaß gewinnen. - Etwa gleichzeitig entstand die Bruderschaft des hl. Leichnams innerhalb des Braugewerks der Mälzer304). Sie hielt ihre Feiern am Fronleichnamsaltar in der Pfarrkirche. Dort ist bereits das, was über die religiösen Feiern des Gewerks bekannt ist, mitgeteilt305). Die beiden Pfarrkirchen und die drei Kapellen mit ihren zahlreichen Altären, von denen mehrere mit zwei Ministerien aus- gestattet waren, erforderten ein bedeutendes Personal von Klerikern. An der Pfarrkirche amtierte ein Pfarrer mit drei Kaplänen, von denen der eine mit der Predigttätigkeit, der andere mit der Seelsorge, der dritte mit dem Lesen der Früh- messe beauftragt war. An der Schloßkirche war ein Pfarrer und ein Kaplan angestellt. Außerdem dürfte etwa ein Dutzend Alta- risten vorhanden gewesen sein, deren Besoldung sicherlich sehr kärglich war. Vielfach mögen sie im Unterricht an der Schule einen Nebenerwerb gefunden haben. Äußerlich angesehen befand sich am Ausgange des XV. Jahr- hunderts das Lübener Kirchensystem in glänzender Verfassung. Eine Stiftung reihte sich an die andere, die Mittel für kirchliche Zwecke flossen reichlich, waren doch noch am Anfange des XVIII. 300 Inkorporationsbuch des Bischofs Thurzo (II b 4) 22.3.1517. 301 cf. Rep. 3 L.B.W. 852 und Inkorporationsbuch Thurzo 7.7.1519. 302 Consignation Seite 12 Nr. 7. 303 Inkorporationsbuch des Bischofs Rudolph II b 3, ohne genaue- res Datum. 304 Zuerst erwähnt 9.1.1484 Rep. 3 L.B.W. 809; ferner: ebenda 814 23.3.1489,815 13.4.1489, 817 12.3.1490 und so fort. Zuletzt Nr. 875 8.11.1549. 305 Liste der Altäre Nr. 12. |
- 71 - Jahrhunderts in der Liegnitzer Regierungskanzlei 365 Urkunden der Lübener Pfarre vorhanden306), von denen etwa 177 in den Besitz des Breslauer Staatsarchivs übergegangen sind. Es fehlte jedenfalls nicht an einer tiefen religiösen Unterströmung im Volke, die sich eben in der Freigebigkeit für fromme Stiftungen und in der Neigung zu religiösen Übungen äußerte. Es herrschte allerdings das Interesse für Sicherstellung des Seelenheils durch Messe- und Altarstiftungen, Seelgeräte, Jahrgezeiten vor, während für allgemein-kirchliche und humane Zwecke verhältnis- mäßig wenig Sinn vorhanden war. Nur zwei Vermächtnisse für Arme sind unter den zahlreichen Stiftungsurkunden nachweis- bar307). Die Zinsen der zahlreichen Stiftungskapitalien flossen fast ausnahmslos in die Taschen der zahlreichen Kleriker. Diese mögen oft genug einen mehr oder minder spürbaren Druck darauf ausgeübt haben, daß die ihnen gebührenden Bezüge wuchsen. Jedenfalls waren sie nicht unschuldig daran, wenn in weiten Kreisen die Anschauung obwaltete, daß der ganze kirchliche Betrieb auf die Ausbeutung des Volkes berechnet wäre. Ein jedenfalls unverdächtiger Zeuge, Kaspar von Schwenckfeld, dessen Zuver- lässigkeit und Wahrheitsliebe auch von seinen Gegnern nie be- stritten worden ist, schreibt darüber bittere Worte, die für uns darum von Interesse sind, weil er dabei jedenfalls die Dörfer in der Umgebung Lübens im Auge gehabt hat. Er klagt308): "Auf den Dörfern geht es ärger zu als bei den Heiden. Niemand will sich des Bäuerleins annehmen; sie werden ohne Unterlaß ganz tyrannisch mit unerträglichen Gesetzen von ihren ungelehrten Pfarrern umgetrieben, daß es wohl zu erbarmen ist, wie der größte Hauf ihm große Gewissen nimmt, und dies aus unseligen Wirren der Pfarrer. - Die Mönche drücken das Land mit ihrem unseligen Bettel, diese elenden unnützen Leute, die ihre guten Werke, der sie selber keins haben, anderen um Geld pflegen zu verkaufen. Sie halten Messe und gehen zu Chor um Geldes 306 O. A. Lüben I Consignation der Briefschaften der Pfarrei Lüben, vermutlich bei der Rekatholisierung der Kirche 1707 aufgestellt. Nur 67 Urkunden sind inhaltlich skizziert, von denen etwa 25 nicht im Staatsarchiv vorhanden sind. Summarisch werden 172 Pergamentbriefe, darunter etliche von alten Herzögen, Herzogin Margarete usw. aus dem XIV. und XV. Jahrhundert über Stiftungen für Kirchen und Kapellen zusammengefaßt. 307 Rep. 3 L.B.W. 932 24.5.51409. Konrad Cromer vermacht. 7 1/2 Mark Jahreszins, die zur Bekleidung von Armen dienen sollen. Nr. 933 13.9.1471. Stephan Rewsindorf vermacht jährlich 18 gr. für Schuhe und andere Notdurft an arme Leute. Ein Testamentsregister, von 1599-1606 reichend (O. A. Lüben I Rechnungsakten) weist ein Kapital von 900 Mark auf, dessen Zinsen zur Bekleidung armer Leute verwendet wurden. 308 Die folgenden Zitate aus Schwenckfelds Schriften sind der Schrift Th. Hoffmans "Caspar Schwenckfelds Leben und Lehren" Tl. I 1897 entnommen. |