


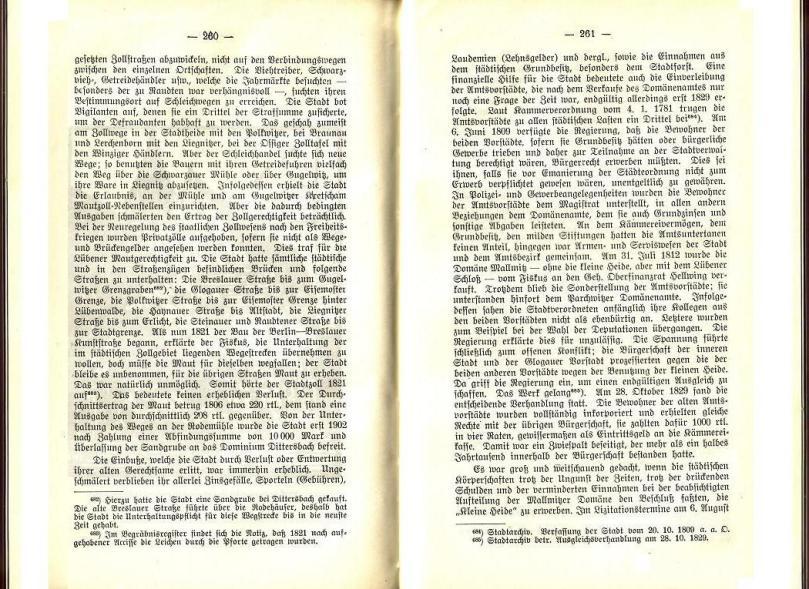
|
- 260 - gesetzten Zollstraßen abzuwickeln, nicht auf den Verbindungswegen zwischen den einzelnen Ortschaften. Die Viehtreiber, Schwarz- vieh-, Getreidehändler usw., welche die Jahrmärkte besuchen - besonders der zu Raudten war verhängnisvoll -, suchten ihren Bestimmungsort auf Schleichwegen zu erreichen. Die Stadt bot Vigilanten auf, denen sie ein Drittel der Strafsumme zusicherte, um der Defraudanten habhaft zu werden. Das geschah zumeist am Zollwege in der Stadtheide mit den Polkwitzer, bei Braunau und Lerchenborn mit den Liegnitzer, bei der Ossiger Zolltafel mit den Winziger Händlern. Aber der Schleichhandel suchte sich neue Wege; so benutzten die Bauern mit ihren Getreidefuhren vielfach den Weg über die Schwarzauer Mühle oder über Gugelwitz, um ihre Ware in Liegnitz abzusetzen. Infolgedessen erhielt die Stadt die Erlaubnis an der Mühle und am Gugelwitzer Kretscham Mautzoll-Nebenstellen einzurichten. Aber die dadurch bedingten Ausgaben schmälerten den Ertrag der Zollgerechtigkeit beträchtlich. Bei der Neuregelung des staatlichen Zollwesens nach den Freiheits- kriegen wurden Privatzölle aufgehoben, sofern sie nicht als Wege- und Brückengelder angesehen werden konnten. Dies traf für die Lübener Mautgerechtigkeit zu. Die Stadt hatte sämtliche städtische und in den Straßenzügen befindlichen Brücken und folgende Straßen zu unterhalten: Die Breslauer Straße bis zum Gugel- witzer Grenzgraben682), die Glogauer Straße bis zur Eisemoster Grenze, die Polkwitzer Straße bis zur Eisemoster Grenze hinter Lübenwalde, die Haynauer Straße bis Altstadt, die Liegnitzer Straße bis zum Erlicht, die Steinauer und Raudtener Straße bis zur Stadtgrenze. Als nun 1821 der Bau der Berlin-Breslauer Kunststraße begann, erklärte der Fiskus, die Unterhaltung der im städtischen Zollgebiet liegenden Wegestrecken übernehmen zu wollen, doch müsse die Maut für dieselben wegfallen; der Stadt bleibe es unbenommen, für die übrigen Straßen Maut zu erheben. Das war natürlich unmöglich. Somit hörte der Stadtzoll 1821 auf683). Das bedeutete keinen erheblichen Verlust. Der Durch- schnittsertrag der Maut betrug 1806 etwa 220 rtl., dem stand eine Ausgabe von durchschnittlich 208 rtl. gegenüber. Von der Unter- haltung des Weges an der Rodemühle wurde die Stadt erst 1902 nach Zahlung einer Abfindungssumme von 10 000 Mark und Überlassung der Sandgrube an das Dominium Dittersbach befreit. Die Einbuße, welche die Stadt durch Verlust oder Entwertung ihrer alten Gerechtsame erlitt, war immerhin erheblich. Unge- schmälert verblieben ihr allerlei Zinsgefälle, Sporteln (Gebühren), 682 Hierzu hatte die Stadt eine Sandgrube bei Dittersbach gekauft. Die alte Breslauer Straße führte über die Rodehäuser, deshalb hat die Stadt die Unterhaltspflicht für diese Wegstrecke bis in die neuste Zeit gehabt. 683 Im Begräbnisregister findet sich die Notiz, daß 1821 nach auf- gehobener Accisse die Leichen durch die Pforte getragen wurden. |
- 261 - Laudemien (Lehnsgelder) und dergl., sowie die Einnahmen aus dem städtischen Grundbesitz, besonders dem Stadtforst. Eine finanzielle Hilfe für die Stadt bedeutete auch die Einverleibung der Amtsvorstädte, die nach dem Verkaufe des Domänenamtes nur noch eine Frage der Zeit war, endgültig allerdings erst 1829 er- folgte. Laut Kammerverordnung vom 4.1.1781 trugen die Amtsvorstädte zu allen städtischen Lasten ein Drittel bei684). Am 6. Juni 1809 verfügte die Regierung, daß die Bewohner der beiden Vorstädte, sofern sie Grundbesitz hätten oder bürgerliche Gewerbe trieben und daher zur Teilnahme an der Stadtverwal- tung berechtigt ären, Bürgerrechte erwerben müßten. Dies sei ihnen, falls sie vor Emanierung der Städteordnung nicht zum Erwerb verpflichtet gewesen wären, unentgeltlich zu gewähren. In Polizei- und Gewerbeangelegenheiten wurden die Bewohner der Amtsvorstädte dem Magistrat unterstellt, in allen andern Beziehungen dem Domänenamte, dem sie auch Grundzinsen und sonstige Abgaben leisteten. An dem Kämmereivermögen, dem Grundbesitz, den milden Stiftungen hatten die Amtsuntertanen keinen Anteil, hingegen war Armen- und Serviswesen der Stadt und dem Amtsbezirk gemeinsam. Am 31. Juli 1812 wurde die Domäne Mallmitz - ohne die kleine Heide, aber mit dem Lübener Schloß - vom Fiskus an den Geh. Oberfinanzrat Hellwig ver- kauft. Trotzdem blieb die Sonderstellung der Amtsvorstädte; sie unterstanden hinfort dem Parchwitzer Domänenamte. Infolge- dessen sahen die Stadtverordneten anfänglich ihre Kollegen aus den beiden Vorstädten nicht als ebenbürtig an. Letzere wurden zum Beispiel bei der Wahl der Deputationen übergangen. Die Regierung erklärte dies für unzulässig. Die Spannung führte schließlich zum offenen Konflikt; die Bürgerschaft der inneren Stadt und der Glogauer Vorstadt prozessierten gegen die der beiden anderen Vorstädte wegen Benutzung der kleinen Heide. Da griff die Regierung ein, um einen endgültigen Ausgleich zu schaffen. Das Werk gelang685). Am 28. Oktober 1829 fand die entscheidende Verhandlung statt. Die Bewohner der alten Amts- vorstädte wurden vollständig inkorporiert und erhielten gleiche Rechte mit der übrigen Bürgerschaft, sie zahlten dafür 1000 rtl. in vier Raten, gewissermaßen als Eintrittsgeld an die Kämmerei- kasse. Damit war ein Zwiespalt beseitigt, der mehr als ein halbes Jahrtausend innerhalb der Bürgerschaft bestanden hatte. Es war groß und weitsichtig gedacht, wenn die städtischen Körperschaften trotz der Ungunst der Zeiten, trotz der drückenden Schulden und der verminderten Einnahmen bei der beabsichtigten Aufteilung der Mallmitzer Domäne den Beschluß faßten, die "Kleine Heide" zu erwerben. Im Lizitationstermine am 6. August 684 Stadtarchiv. Verfassung der Stadt vom 20.10.1809 a. a. O. 685 Stadtarchiv betr. Ausgleichsverhandlung am 28.10.1829. |