


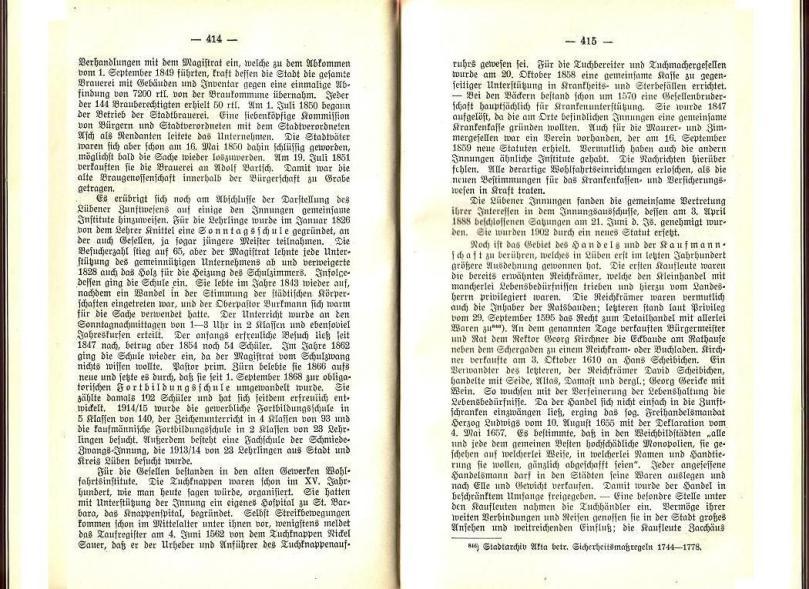
|
- 414 - Verhandlungen mit dem Magistrat ein, welche zu dem Abkommen vom 1. September 1849 führten, kraft dessen die Stadt die gesamte Brauerei mit Gebäuden und Inventar gegen eine einmalige Ab- findung von 72 000 rtl. von der Braukommune übernahm. Jeder der 144 Brauberechtigten erhielt 50 rtl. Am 1. Juli 1850 begann der Betrieb der Stadtbrauerei. Eine siebenköpfige Kommission von Bürgern und Stadtverordneten mit dem Stadtverordneten Asch als Rendanten leitete das Unternehmen. Die Stadtväter waren sich aber schon am 16. Mai 1850 dahin schlüssig geworden, möglichst bald die Sache wieder loszuwerden. Am 19. Juli 1851 verkauften sie die Brauerei an Adolf Bartsch. Damit war die alte Braugenossenschaft innerhalb der Bürgerschaft zu Grabe getragen. Es erübrigt sich noch am Abschlusse der Darstellung des Lübener Zunftwesens auf einige den Innungen gemeinsame Institute hinzuweisen. Für die Lehrlinge wurde im Januar 1826 von dem Lehrer Knittel eine Sonntagsschule gegründet, an der auch Gesellen, ja sogar jüngere Meister teilnahmen. Die Besucherzahl stieg auf 65, aber der Magistrat lehnte jede Unter- stützung des gemeinnützigen Unternehmens ab und verweigerte 1828 auch das Holz für die Heizung des Schulzimmers. Infolge- dessen ging die Schule ein. Sie lebte im Jahre 1843 wieder auf, nachdem ein Wandel in der Stimmung der städtischen Körper- schaften eingetreten war, und der Oberpastor Burkmann sich warm für die Sache verwendet hatte. Der Unterricht wurde an den Sonntagnachmittagen von 1-3 Uhr in 2 Klassen und ebensoviel Jahreskursen erteilt. Der anfangs erfreuliche Besuch ließ seit 1847 nach, betrug aber 1854 noch 54 Schüler. Im Jahre 1862 ging die Schule wieder ein, da der Magistrat vom Schulzwang nichts wissen wollte. Pastor prim. Zürn belebte sie 1866 aufs neue und setzte es durch, daß sie seit 1. September 1868 zur obliga- torischen Fortbildungsschule umgewandelt wurde. Sie zählte damals 102 Schüler und hat sich seitdem erfreulich ent- wickelt. 1914/15 wurde die gewerbliche Fortbildungsschule in 5 Klassen von 140, der Zeichenunterricht in 4 Klassen von 93 und die kaufmännische Fortbildungsschule in 2 Klassen von 23 Lehr- lingen besucht. Außerdem besteht eine Fachschule der Schmiede- Zwangs-Innung, die 1913/14 von 23 Lehrlingen aus Stadt und Kreis Lüben besucht wurde. Für die Gesellen bestanden in den alten Gewerken Wohl- fahrtsinstitute. Die Tuchknappen waren schon im XV. Jahr- hundert, wie man heute sagen würde, organisiert. Sie hatten mit Unterstützung der Innung ein eigenes Hospital zu St. Bar- bara, das Knappenhospital begründet. Selbst Streikbewegungen kommen schon im Mittelalter unter ihnen vor, wenigstens meldet das Taufregister am 4. Juni 1562 von dem Tuchknappen Nickel Sauer, daß er der Urheber und Anführer des Tuchknappenauf- |
- 415 - ruhrs gewesen sei. Für die Tuchbereiter und Tuchmachergesellen wurde am 20. Oktober 1858 eine gemeinsame Kasse zu gegen- seitiger Unterstützung in Krankheits- und Sterbefällen errichtet. - Bei den Bäckern bestand schon um 1570 eine Gesellenbruder- schaft hauptsächlich für Krankenunterstützung. Sie wurde 1847 aufgelöst, da die am Orte befindlichen Innungen eine gemeinsame Krankenkasse gründen wollten. Auch für die Maurer- und Zim- mergesellen war ein Verein vorhanden, der am 16. September 1859 neue Statuten erhielt. Vermutlich haben auch die andern Innungen ähnliche Institute gehabt. Die Nachrichten hierüber fehlen. Alle derartige Wohlfahrtseinrichtungen erloschen, als die neuen Bestimmungen für das Krankenkassen- und Versicherungs- wesen in Kraft traten. Die Lübener Innungen fanden die gemeinsame Vertretung ihrer Interessen in dem Innungsausschusse, dessen am 3. April 1888 beschlossenen Satzungen am 21. Juni d. Js. genehmigt wur- den. Sie wurden 1902 durch ein neues Statut ersetzt. Noch ist das Gebiet des Handels und der Kaufmann- schaft zu berühren, welches in Lüben erst im letzten Jahrhundert größere Ausdehnung gewonnen hat. Die ersten Kaufleute waren die bereits erwähnten Reichkrämer, welche den Kleinhandel mit mancherlei Lebensbedürfnissen trieben und hierzu vom Landes- herrn privilegiert waren. Die Reichkrämer waren vermutlich auch die Inhaber der Ratsbauden; letzteren stand laut Privileg vom 29. September 1595 das Recht zum Detailhandel mit allerlei Waren zu846). An dem genannten Tage verkauften Bürgermeister und Rat dem Rektor Georg Kirchner die Eckbaude am Rathause neben dem Schergaden zu einem Reichkram- oder Buchladen. Kirch- ner verkaufte am 3. Oktober 1610 an Hans Scheibichen. Ein Verwandter des letzteren, der Reichkrämer David Scheibichen, handelte mit Seide, Atlas, Damast und dergl.; Georg Gericke mit Wein. So wuchsen mit der Verfeinerung der Lebenshaltung die Lebensbedürfnisse. Da der Handel sich nicht einfach in die Zunft- schranken einzwängen ließ, erging das sog. Freihandelsmandat Herzog Ludwigs vom 10. August 1655 mit der Deklaration vom 4. Mai 1657. Es bestimmte, daß in den Weichbildstädten "alle und jede dem gemeinen Besten hochschädliche Monopolien, sie ge- schehen auf welcherlei Weise, in welcherlei Namen und Handtie- rung sie wollen, gänzlich abgeschafft seien". Jeder angesessene Handelsmann darf in den Städten seine Waren auslegen und nach Elle und Gewicht verkaufen. Damit wurde der Handel in beschränktem Umfange freigegeben. - Eine besondre Stelle unter den Kaufleuten nahmen die Tuchhändler ein. Vermöge ihrer weiten Verbindungen und Reisen genossen sie in der Stadt großes Ansehen und weitreichenden Einfluß; die Kaufleute Zacchäus 846 Stadtarchiv Akta betr. Sicherheitsmaßregeln 1744-1778. |