
Rudolf-Christoph Freiherr von Gersdorff (1905-1980) |
|
Rudolf-Christoph Freiherr von Gersdorff (1905-1980) Mit einem großen Festakt benannte die Bundeswehr am 25. November 1981 die frisch renovierte ehemalige belgische "Loncin-Kaserne" in Euskirchen um. Neuer Namensgeber der Bundeswehr-Kaserne, in der das Jägerbataillon 532 und das Feldartilleriebataillon 535 beheimatet ist, wurde der am 27.3.1905 in Lüben geborene Rudolf-Christoph Freiherr von Gersdorff. Welche Verdienste werden damit geehrt? Und warum blieb der Mann in den Kreisen der Lübener dennoch so unbekannt - oder gar unerwünscht? Der Vater, Rittmeister von Gersdorff, wurde von Kaiser Wilhelm II., bei dem er jahrelang persönlicher Adjutant war, zum Dragoner-Regiment nach Lüben versetzt. Rudolf-Christoph von Gersdorff besuchte mit seinen Brüdern Ernst Carl und Hubertus und einer Schwester in Lüben das Gymnasium, legte dort das Abitur ab und schlug die Offizierslaufbahn ein. 1941 stieß der Generalstabsoffizier zur Widerstandsgruppe um Tresckow. Bei einem versuchten Attentat auf Hitler war Gersdorff bereit, sein eigenes Leben zu opfern, um den Tyrannen zu ermorden. |
 Der Standortälteste, Oberst Walter Schmidt-Bleker, neben dem Denkmal für den Namensgeber der Bundeswehr-Kaserne in Euskirchen, Rudolf-Christoph Freiherr von Gersdorff. |
Protokoll eines gescheiterten Attentats
Der erfolgreiche Tyrannenmord hat drei Voraussetzungen: eine gute Gelegenheit, einen überzeugten Attentäter - und etwas Glück. Bei Adolf Hitler kamen diese drei Voraussetzungen allerdings nie zusammen. Bei Georg Elsers Anschlag in München am 8. November 1939 nicht, ebensowenig bei Stauffenbergs Bombe im Führerhauptquartier "Wolfsschanze" am 20. Juli 1944. Und auch nicht im Berliner Zeughaus am 21. März 1943.
Es ist einer der letzten öffentlichen Auftritte des selbsternannten "größten Feldherren aller Zeiten": Am "Heldengedenktag", der Nazi-Variante des Volkstrauertags, will der "Führer" wie jedes Jahr die deutschen Gefallenen des vergangenen und des gegenwärtigen Weltkrieges ehren. Als geeignete Kulisse dient das Heeresmuseum im barocken Zeughaus Unter den Linden. Anders als gewöhnlich wird der "Heldengedenktag" in diesem Jahr, wenige Monate nach der katastrophalen Niederlage von Stalingrad, nicht am fünften Sonntag vor Ostern gefeiert, sondern eine Woche später: Hitler hat die Verlegung befohlen, weil er auf einen Erfolg an der Ostfront hofft. Und tatsächlich: Am 15. März 1943 erobern zwei SS-Divisionen die sowjetische Stadt Charkow zurück.

Nun sagt Hitler seine Teilnahme an der Berliner Feier zu. Das Programm steht am 16. März fest: Irgendwann zwischen dem späten Vormittag und dem frühen Nachmittag des kommenden Sonntags (genauere Zeitangaben gibt es bei öffentlichen Hitler-Auftritten während des Krieges nicht mehr, um den britischen Bombern nicht ein lohnendes Ziel zu bieten) wird der "Führer" ins Zeughaus kommen, im Innenhof unter dem Glasdach eine Ansprache halten, danach eine Ausstellung mit sowjetischen Beutewaffen im Erdgeschoß besichtigen und schließlich vor der Neuen Wache eine Parade abnehmen.
Mit diesem Programm steht auch für den Kopf des militärischen Widerstands gegen Hitler, Oberst im Generalstab Henning von Tresckow, fest, daß ein neuer Anlauf unternommen werden muß, Hitler zu töten. Die Beutewaffen-Ausstellung bietet die Gelegenheit. Denn sie ist von einer Abteilung in Tresckows Generalstab der Heeresgruppe Mitte zusammengestellt worden. Trotz einiger Probleme können es die Widerständler arrangieren, daß Oberstleutnant Rudolf-Christoph von Gersdorff als Experte an der Besichtigung teilnehmen darf. Gersdorff, ein damals 38jähriger Freiherr aus Lüben/Schlesien, gehört zu den engsten Mitarbeitern Tresckows, ist bis dahin aber nicht aktiv am Widerstand beteiligt. Nun soll er die Gelegenheit bekommen, ganz nah an den Tyrannen heranzukommen. Er ist bereit, sein Leben zu opfern - seit 1942 ist Gersdorff Witwer und hat auf dieser Welt nichts mehr zu verlieren. Allerdings will er die Gewißheit, daß sein Tod sinnvoll ist.
Ein Attentat mit der Pistole kommt nicht in Frage - angesichts des extremen Personenschutzes Hitlers wäre viel zu unsicher, ob es gelingt. Bleibt die Möglichkeit, sich an der Seite des "Führers" in die Luft zu sprengen. Doch womit? Selbst hohen Offizieren fällt es nicht leicht, an genug explosives Material heranzukommen. Schließlich treibt die Gruppe zwei erbeutete Haftminen britischer Bauart auf. Doch womit soll man sie zünden? Mechanische Zünder ticken so laut, daß die Leibwächter garantiert aufmerksam geworden wären; die lautlosen aus deutscher Produktion passen aber nicht in die britischen Minen - so bleiben nur die originalen britischen Säurezünder, die eine Verzögerung zwischen zehn und fünfzehn Minuten haben.
Nach dem geheimen Zeitplan soll nach Hitlers Ansprache (deren Länge zwischen 15 Minuten und anderthalb Stunden schwanken konnte) die Besichtigung der Beutewaffen beginnen und etwa zwanzig Minuten dauern. Genug Zeit also, um die Explosion in Hitlers unmittelbarer Nähe stattfinden zu lassen.
Vor dem "Heldengedenktag" ist Propagandaminister Joseph Goebbels aufgeregt. Am frühen Morgen des 21. März diktiert er seinem Sekretär einige Sätze für seine sogenannten Tagebücher: "Für Berlin lasse ich totale Luftschutzvorbereitungen für den Heldengedenktag treffen. Die Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften sind in Alarmbereitschaft versetzt worden. Sollte ein größerer Luftangriff auf Berlin stattfinden, so hätten wir Hilfskräfte, wie wir sie zahlenmäßig bisher noch nie besessen haben."
Der Frühling bricht aus an diesem 21. März 1943, die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel. Von "Führerwetter" murmeln die Berliner, die sich zu Zehntausenden rund ums abgesperrte Zeughaus versammelt haben, um einen Blick auf den Staatschef zu erhaschen. Ab elf Uhr versammeln sich die geladenen Gäste im Lichthof, doch sie müssen mehr als zwei Stunden warten. Gegen 13 Uhr trifft der Diktator ein. Ein Orchester spielt den sehr getragenen ersten Satz aus Anton Bruckners 7. Sinfonie, dann wendet sich Hitler dem Rednerpult zu. Er faßt sich kurz: Nur etwa zwölf Minuten dauert sein rhetorischer Angriff auf die Kriegsgegner. Unmittelbar nach dem Applaus zerdrückt Gersdorff die Säureampulle des Zünders in einer der beiden Minen, die er in seinen Manteltaschen bei sich trägt. Von nun an zehn bis 15 Minuten.
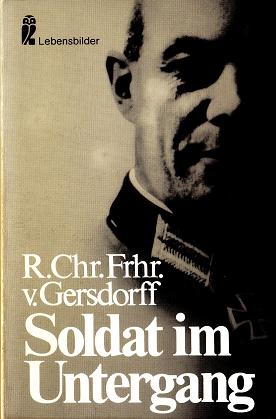
Gersdorff hat mit seinem Leben abgeschlossen und beeilt sich, hinter seinem "obersten Kriegsherrn" herzulaufen. Doch der interessiert sich keine Sekunde für die ausgestellten Waffen, sondern hastet durch die Ausstellung. Selbst der Reporter, der für den Reichsrundfunk live vom "Heldengedenktag" überträgt, ist überrascht, als der "Führer" nach nur gut zwei Minuten wieder aus dem Zeughaus tritt, um die Parade abzunehmen. Gersdorff, der eine scharfe Mine bei sich trägt, sucht stramm und mit schweißnassem Gesicht die nächste Toilette auf und "entsorgt" den Säurezünder. Die Gelegenheit und der entschlossene Attentäter waren da, am 21. März 1943 im Zeughaus - nur das Quentchen Glück fehlte, den Massenmörder Adolf Hitler umzubringen.
Quelle: www.welt.de
Weitere biografische Informationen über von Gersdorff
Autobiographie "Soldat im Untergang", Ullstein Buch Nr. 34008, 1977.
Auszüge aus seinen Erinnerungen "Soldatenleben in Schlesien":
Der eigentlich humorvoll gemeinte Ausspruch: "Schlesien ist eine geglückte Kombination von preußischer Genauigkeit und österreichischer Gemütlichkeit" birgt fraglos viel Wahrheit in sich. Dies bekam vor allem zu spüren, wer als Soldat aus anderen Teilen Deutschlands in eine schlesische Garnison versetzt wurde und sich hier bei aller Pflichterfüllung und strenger Dienstauffassung sehr bald von dem liebenswürdigen Charme, der inneren Aufgeschlossenheit und der offenen und herzlichen Gastfreundschaft der schlesischen Menschen überzeugen konnte. Die Soldaten aber, die selbst Schlesier waren und wenigstens die längste Zeit ihres militärischen Dienstes in ihrer Heimatprovinz erleben konnten, brachten diese von der Landschaft, von der Geschichte und den Menschen Schlesiens geprägte Mischung aus "Korrektheit und Liebenswürdigkeit" von sich aus mit. Sie konnten alle inneren und äußeren Freuden ihres Soldatenlebens genießen und dabei mithelfen, einen der besten Soldatentypen zu schaffen, den Preußen in Deutschland seit der Zeit Friedrichs des Großen je hervorgebracht hat.
Ich habe das Glück gehabt, als Soldatenkind in einer kleinen niederschlesischen Garnisonstadt aufzuwachsen und dann von 1923 bis 1947 als Kavallerist in Lüben, Breslau und Brieg meine militärischen Lehrjahre zu erleben. Aus dieser Zeit, der schönsten und sorglosesten meines Erdenweges, nehme ich mir das Recht, über ein Soldatenleben in Schlesien zu berichten, das glücklicher nirgendwo anders gewesen sein könnte.
Das "freundliche Lindenstädtchen" Lüben im Regierungsbezirk Liegnitz, in dem ich meine Kindheit, Schul- und Rekrutenzeit verlebte, war mit seinen etwa 5.000 Einwohnern eine der typischen kleinen Kavalleriegarnisonen Schlesiens, die mit ihrem Regiment, dem Dragonerregiment von Bredow (1. Schles.) Nr. 4. eng verwachsen war. Seit meiner frühesten Jugend ist mir das blaugelbe Tuch der Dragoner, das auch mein Vater trug, vertraut. Das Straßenbild der kleinen Stadt wurde von ihm beherrscht, und das ganze Leben in ihr schien sich in erster Linie um die Garnison zu drehen.
Das konnte man besonders am Sonntag feststellen, wenn das Trompeterkorps des Dragonerregiments unter der Stabführung des rotbärtigen Stabstrompeters Pohlmann nach der Kirchzeit auf dem Ring konzertierte. Dann war jeder Fensterplatz besetzt, und die meisten übrigen Bewohner des Städtchens promenierten um ihren Markplatz herum. Vor dem wegen seiner guten Küche bekannten Hotel Grüner Baum, vor dem noch die einzige "Laube" stand, die im Siebenjährigen Krieg den von einem österreichischen Pandurenführer - er trug ausgerechnet meinen Namen - ausgelösten Brand überlebt hatte, standen oder saßen die prominentesten Bürger und das Offizierscorps mit ihren Damen, und man hatte das Gefühl, daß Bürger und Soldaten weder Geheimnisse voreinander hatten, noch durch irgendwelche Schranken voneinander getrennt waren.
Die Bürgerschaft nahm am Schicksal und an den persönlichen Verhältnissen der damals meist viele Jahre in der Stadt lebenden Offiziere und ihrer Familien unmittelbar teil. Meine Eltern, die seit dem Jahr 1900 in Lüben wohnten, hießen bei allen Bürgern nur "Vatel und Muttel". Sie waren eben "Lübener". Noch nach vielen Jahren, als meine Mutter nach dem Tod meines Vaters nach Breslau verzogen war, sagte mir ein Lübener Bürger: "Seitdäm de Muttel nich mähr ei Lieben is, is hier nischt mähr los." Wir Kinder wurden selbstverständlich von allen Bürgern, als wir schon erwachsen waren, noch geduzt, und als ich nach Jahren einmal in meiner Geburtsstadt in Zivil zum alten Friseur Gottschling ging, fragte er mich: "Nu soag amoal, wus bischte denn derweil gewurden?" Als ich ihm darauf erzählte, daß ich Rittmeister und Schwadronschef sei, meinte er nur: ,Nu sieh ock, doa mechte man dich ja baale siezen!" Er ließ es aber gottlob beim - natürlich einseitigen - Du.
Lüben war ebenso wie andere Kreisstädte mit der Landbevölkerung der Umgebung eng verbunden. Dies übertrug sich auch auf die Garnison, zumal die Bauernsöhne meist bei "a Dragunern" ihren Wehrdienst ableisteten, und im übrigen durch die zahlreichen kleinen Marsch- und Felddienstübungen im Kreisgebiet ein herzliches Verhältnis zwischen Landleuten und Soldaten entstanden war. So wuchsen Stadt und Land mit ihren Dragonern zu einer großen Familie zusammen. Das zeigte sich auch besonders bei den "Kaiser-Geburtstagsfeiern" am jeweiligen 27. Januar. Am Vormittag dieses Tages fanden eine Paradeaufstellung und ein Vorbeimarsch zu Fuß auf dem Ring statt, wozu sich neben der gesamten Bürgerschaft bereits ein großer Teil der Landbevölkerung einfand. Für uns Kinder war es stets ein Hauptspaß, danach die zahlreichen Sporen einzusammeln, die sich die im Parademarsch wenig geübten Dragoner abgetreten hatten. Abends feierten die fünf Schwadronen einzeln in den Gasthöfen der Stadt mit ihren zahlreichen Gästen, wobei dem allgemeinen Tanz immer teils ernste, teils heitere Aufführungen vorangingen. Hierfür hatten sich gewisse Regeln herausgebildet. Nach einem Prolog folgte ein lebendes Bild, bei dem sich um eine - meist von einem Dragoner dargestellt - "Germania" Soldaten in historischen und neuzeitlichen Uniformen gruppierten. Dann schlossen sich Vortrags- und Gesangsdarbietungen sowie ein kleines, entweder sehr derbkomisches oder sehr rührseliges Theaterstück an. Für mich waren diese Veranstaltungen Höhepunkte meiner Jugend und bestärkten noch den Wunsch, einmal Soldat zu werden. Auch nach dem Ersten Weltkrieg hatte sich an dem guten Verhältnis zwischen Bevölkerung und Soldaten wenig oder gar nichts geändert. Wenn auch in Lüben inzwischen zwei Schwadronen des Reiterregiments Nr. 7 (Breslau) standen, so hießen ihre Angehörigen doch weiterhin in Stadt und Land die "Draguner", bei denen jetzt nur die blaugelben Farben vermißt wurden.
Ich trat am 1. April 1923 in die Traditionseskadron der Bredow-Dragoner in Lüben ein und erlebte hier eine harte, aber glückliche Rekrutenzeit. Damals gab es noch keine "Fahnenjunker oder Offiziersanwärter", denen irgendwelche "Privilegien" zugestanden hätten. Ich war Rekrut, wie jeder andere, wenn auch mein Vater als ehemaliger Kommandeur des Regiments und Generalmajor a. D. nur wenige hundert Meter von der Kaserne entfernt wohnte.
Wir jungen Soldaten standen unter der Fuchtel der noch im Krieg gewesenen Obergefreiten, von denen mir insbesondere der "Sonntag-Kalle" und der "Schwarze-Paul" in "schlagwürdiger", aber auch dankbarer Erinnerung sind. Wenn sie einem zwanzig Paar völlig verdreckter Stiefel zum Putzen vor die Füße warfen oder am Sonnabendnachmittag die grade "gewienerten" und auf Hochglanz polierten fünf Kandarenzeuge in den mit Wasser gefüllten Stalleimer tunkten, weil sie ihrer Ansicht nach nicht blank genug waren, wenn sie uns Rekruten Putzzeuge, Lanzenflaggen und andere Ausrüstungsstücke "klauten", um sie dann wieder an uns zu "verkaufen", dann hätte man manchmal am Leben schier verzweifeln können. Wenn aber die gleichen "Quälgeister" dem 18jährigen, viel zu schnell gewachsenen Junget' die mit feuchtem Dung beladenen und daher überschweren Mistkästen abnahmen und ihm dafür eine leichte Stallarbeit zuteilten, dann merkte man immer wieder das "guldene schläsische Herze".
Mit den anderen Rekruten verband mich eine enge Kameradschaft, die unter Aufrechterhaltung des gewohnten "Du" (natürlich nur außer Dienst) auch anhielt, als ich Offizier im gleichen Regiment war, und die bis in die heutigen Tage ihre - im wahrsten Sinne des Wortes - Feuerprobe bestanden hat. Uns allen hat die harte Rekrutenzeit nicht geschadet. Mir als zukünftigem Offizier aber war sie Lehrmeisterin für meine "Innere Führung" als Rekrutenerzieher und später als Schwadronschef. Nach Absolvierung der Kriegsschulen, des Fähnrich- und Offizierexamens kam ich dann 1926 nach Breslau in die Kürassierskaserne, wo der Regimentsstab und die anderen Schwadronen des Reiterregiments 7 garnisoniert waren...
...Als Kriegsordonnanz war mir der Gefreite Paul Kühn zugeteilt. Er war etwa so alt wie ich und war in meiner schlesischen Heimatstadt Lüben in der Polkwitzer (später Hindenburg-) Straße 12 geboren, während meine Eltern die Nr. 13 derselben Straße bewohnten. Wir hatten als Jungen zusammen gespielt, hatten uns dann aber aus den Augen verloren. Vom Beginn des Rußlandfeldzuges an hat mich Paul Kühn bis zu seinem Tod nicht verlassen. Schon in Rußland hatten wir mehrere aufregende Abenteuer gemeinsam zu bestehen, wobei ich immer die Selbstverständlichkeit bewunderte, mit der er auch dann, wenn er es eigentlich nicht notwendig hatte, an meiner Seite blieb. Als wir im August 1944, inzwischen nach Frankreich versetzt, eines Tages britischen Churchill-Panzern "in die Arme fuhren" und sich die Offiziere und Fahrer meines Stabes aus den in Brand geschossenen Wagen robbend in die nächste Deckung retteten, konnte ich ihnen wegen einer einige Tage vorher erlittenen Knie-Verletzung nicht folgen. Ich lag bewegungsunfähig mitten im Punktfeuer der etwa 300 m entfernten Feindpanzer. Da kam Paul Kühn aufrecht aus der Deckung heraus auf mich zugelaufen. Als ich ihm den Befehl zurief, sich hinzulegen, meinte er bloß: "Ich muß doch meinen Oberscht holen", und dann zog er mich unter Einsatz seines Lebens aus dem Feuer heraus. Wir kamen anschließend aber doch vorübergehend in britische Gefangenschaft. Als ich eine Gelegenheit fand, mich "dünne" zu machen, genügte ein Wink, um Paul Kühn zu veranlassen, mir zu folgen. Er hat mich nach aufregender, aber geglückter Flucht in einem kleinen Handwagen auf Nebenwegen etwa 30 Kilometer durch die französischen Lande gezogen, so daß wir trotz meiner Verwundung wieder die deutschen Linien erreichten. Als ich Paul Kühn im Januar 1945 das Angebot machte, nach Schlesien zu fahren, um seine Familie und einige meiner Wertsachen vor den eindringenden Sowjets zu retten, lehnte er es einfach ab, mich allein zu lassen. Er ist dann am 20. Februar 1945, neben mir stehend, gefallen. "Ich hatt' einen Kameraden!"
Aus "Soldatenleben in Schlesien" von Rudolf-Christoph Freiherr von Gersdorff in "Meine Schlesischen Jahre" - Erinnerungen aus sechs Jahrzehnten, 2. Teil, Gräfe und Unzer-Verlag, München, herausgegeben von Dr. Herbert Hupka.