


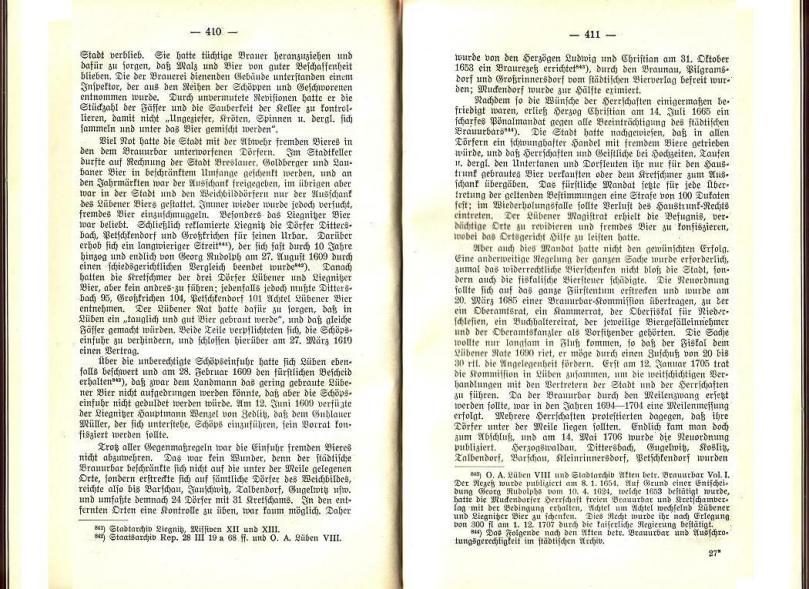
|
- 410 - Stadt verblieb. Sie hatte tüchtige Brauer heranzuziehen und dafür zu sorgen, daß Malz und Bier von guter Beschaffenheit blieben. Die der Brauerei dienenden Gebäude unterstanden einem Inspektor, der aus den Reihen der Schöppen und Geschworenen entnommen wurde. Durch unvermutete Revisionen hatte er die Stückzahl der Fässer und die Sauberkeit der Keller zu kontrol- lieren, damit nicht "Ungeziefer, Kröten, Spinnen u. dergl. sich sammeln und unter das Bier gemischt werden". Viel Not hatte die Stadt mit der Abwehr fremden Bieres in den dem Brauurbar unterworfenen Dörfern. Im Stadtkeller durfte auf Rechnung der Stadt Breslauer, Goldberger und Lau- baner Bier in beschränktem Umfange geschenkt werden, und an den Jahrmärkten war der Ausschank freigegeben, im übrigen aber war in der Stadt und den Weichbilddörfern nur der Ausschank des Lübener Biers gestattet. Immer wieder wurde jedoch versucht, fremdes Bier einzuschmuggeln. Besonders das Liegnitzer Bier war beliebt. Schließlich reklamierte Liegnitz die Dörfer Ditters- bach, Petschkendorf und Großkrichen für seinen Urbar. Darüber erhob sich ein langwieriger Streit841), der sich fast durch 10 Jahre hinzog und endlich von Georg Rudolph am 27. August 1609 durch einen schiedsgerichtlichen Vergleich beendet wurde842). Danach hatten die Kretschmer der drei Dörfer Lübener und Liegnitzer Bier, aber kein andres zu führen; jedenfalls jedoch mußte Ditters- bach 95, Großkrichen 104, Petschkendorf 101 Achtel Lübener Bier entnehmen. Der Lübener Rat hatte dafür zu sorgen, daß in Lüben "ein tauglich und gut Bier gebraut werde", und daß gleiche Fässer gemacht würden. Beide Teile verpflichteten sich, die Schöps- einfuhr zu verhindern, und schlossen hierüber am 27. März 1610 einen Vertrag. Über die unberechtigte Schöpseinfuhr hatte sich Lüben eben- falls beschwert und am 28. Februar 1609 den fürstlichen Bescheid erhalten842), daß zwar dem Landmann das gering gebraute Lübe- ner Bier nicht aufgedrungen werden könnte, daß aber die Schöps- einfuhr nicht geduldet werden würde. Am 12. Juni 1609 verfügte der Liegnitzer Hauptmann Wenzel von Zedlitz, daß dem Guhlauer Müller, der sich unterstehe, Schöps einzuführen, sein Vorrat kon- fisziert werden sollte. Trotz aller Gegenmaßregeln war die Einfuhr fremden Bieres nicht abzuwehren. Das war kein Wunder, denn der städtische Brauurbar beschränkte sich nicht auf die unter der Meile gelegenen Orte, sondern erstreckte sich auf sämtliche Dörfer des Weichbildes, reichte also bis Barschau, Jauschwitz, Talbendorf, Gugelwitz usw. und umfaßte demnach 24 Dörfer mit 31 Kretschams. In den ent- fernten Orten eine Kontrolle zu üben, war kaum möglich. Daher 841 Stadtarchiv Liegnitz, Missiven XII und XIII. 842 Staatsarchiv Rep. 28 III 19 a 68 ff. und O. A. Lüben VIII. |
- 411 - wurde von den Herzögen Ludwig und Christian am 31. Oktober 1653 ein Braurezeß errichtet843), durch den Braunau, Pilgrams- dorf und Großrinnersdorf vom städtischen Bierverlag befreit wur- den; Muckendorf wurde zur Hälfte eximiert. Nachdem so die Wünsche der Herrschaften einigermaßen be- friedigt waren, erließ Herzog Christian am 14. Juli 1665 ein scharfes Pönalmandat gegen alle Beeinträchtigung des städtischen Brauurbars844). Die Stadt hatte nachgewiesen, daß in allen Dörfern ein schwunghafter Handel mit fremdem Biere getrieben würde, und daß Herrschaften und Geistliche bei Hochzeiten, Taufen u. dergl. den Untertanen und Dorfleuten ihr nur für den Haus- trunk gebrautes Bier verkauften oder dem Kretschmer zum Aus- schank übergäben. Das fürstliche Mandat setzte für jede Über- tretung der geltenden Bestimmungen eine Strafe von 100 Dukaten fest; im Wiederholungsfalle sollte Verlust des Haustrunk-Rechts eintreten. Der Lübener Magistrat erhielt die Befugnis, ver- dächtige Orte zu revidieren und fremdes Bier zu konfiszieren, wobei das Ortsgericht Hilfe zu leisten hatte. Aber auch dies Mandat hatte nicht den gewünschten Erfolg. Eine anderweitige Regelung der ganzen Sache wurde erforderlich, zumal das widerrechtliche Bierschenken nicht bloß die Stadt, son- dern auch die fiskalische Biersteuer schädigte. Die Neuordnung sollte sich auf das ganze Fürstentum erstrecken und wurde am 20. März 1685 einer Brauurbar-Kommission übertragen, zu der ein Oberamtsrat, ein Kammerrat, der Oberfiskal für Nieder- schlesien, ein Buchhaltereirat, der jeweilige Biergefälleeinnehmer und der Oberamtskanzler als Vorsitzender gehörten. Die Sache wollte nur langsam in Fluß kommen, so daß der Fiskal dem Lübener Rate 1690 riet, er möge durch einen Zuschuß von 20 bis 30 rtl. die Angelegenheit fördern. Erst am 12. Januar 1705 trat die Kommission in Lüben zusammen, um die weitschichtigen Ver- handlungen mit den Vertretern der Stadt und den Herrschaften zu führen. Da der Brauurbar durch den Meilenzwang ersetzt werden sollte, war in den Jahren 1694-1704 eine Meilenmessung erfolgt. Mehrere Herrschaften protestierten dagegen, daß ihre Dörfer unter der Meile liegen sollten. Endlich kam man doch zum Abschluß, und am 14. Mai 1706 wurde die Neuordnung publiziert. Herzogswaldau, Dittersbach, Gugelwitz, Koslitz, Talbendorf, Barschau, Kleinrinnersdorf, Petschkendorf wurden 843 O. A. Lüben VIII und Stadtarchiv Akten betr. Brauurbar Vol. I. Der Rezeß wurde publiziert am 8.1.1654. Auf Grund einer Entschei- dung Georg Rudolphs vom 10.4.1624, welche 1653 bestätigt wurde, hatte die Muckendorfer Herrschaft freien Brauurbar und Kretschamver- lag mit der Bedingung erhalten, Achtel um Achtel wechselnd Lübener und Liegnitzer Bier zu schenken. Dies Recht wurde ihr nach Erlegung von 300 fl am 1.12.1707 durch die kaiserliche Regierung bestätigt. 844 Das Folgende nach den Akten betr. Brauurbar und Ausschro- tungsgerechtigkeit im städtischen Archiv. |